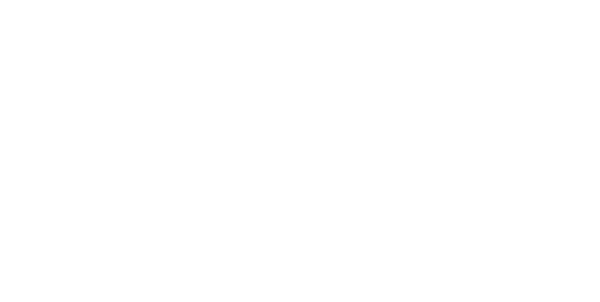So wahnsinnig mutig, wie manche meinen, sei man als Untergrundkünstler in den 1980er-Jahren eigentlich gar nicht gewesen, wiegelt Boris Yukhananov im Gespräch mit dem „Opernglas“ ab. Als der Avantgardekünstler in Moskau und in St. Petersburg die ersten illegalen Kellertheater-Aufführungen organisierte, hätten die Behörden bereits mit den Verfallserscheinungen der Sowjetunion zu kämpfen gehabt, die Verhaftungsgefahr sei daher einigermaßen berechenbar gewesen. Als 1989 die Perestroika den Menschen persönliche Freiheiten brachte, war die Szene längst vernetzt und schaffte es rasch in die westlichen Medien. Ob falsche Bescheidenheit oder nicht: Der Schüler des bedeutenden russischen Theaterregisseurs Anatoly Vasiliev hat sich seine Begeisterung für experimentelle, von manchen Teilen des Publikums als provokant aufgefasste Theaterformen als Gegenkultur zum theatralistischen Mainstream bis heute erhalten.
Im Juni 2013 übernahm Yukhananov überraschend nach einer für Russland raren Ausschreibung das von der Stadt Moskau gut dotierte Stanislawski-Sprechtheater mit rund dreihundert Mitarbeitern – und sperrte es zunächst für umfassende Umbau- und Renovierungsarbeiten zu. Die Ensemblekünstler durften bleiben, mussten aber in der Zwischenzeit proben – anderthalb Jahre lang! Im kommenden Jahr feiert man das fünfjährige Bestehen des als „Stanislawski - Elektrotheater“ wiedereröffneten Hauses.
Der neue Name bezieht sich zum einen auf seine ursprüngliche Funktion als Kinosaal und zum anderen auf dessen Geschichte als Theaterstudio des revolutionären Regisseurs Konstantin Stanislawski. Offiziell ein Sprechtheater, dient es als überdies eindeutig europäisch ausgerichteter Treffpunkt für neue Musik, Literatur und bildende Kunst. Vor allem im Bereich des Musiktheaters möchte man dem in Moskau traditionell konservativ geprägten Theaterleben eine zeitgenössische, freche Komponente hinzuzufügen, man hat immerhin zehn Opern im Repertoire.
Neben Gastregisseuren wie Romeo Castellucci, Heiner Goebbels oder Theodoros Terzopoulos legt freilich auch der Direktor regelmäßig Hand an und besinnt sich mitunter auf alte Ideen: Für die von seinem Musikalischen Leiter Dmitri Kourliandski komponierte Oper »Octavia. Treplanation« grub Boris Yukhananov ein von ihm erstelltes Textbuch aus den wilden 1980er-Jahren aus, in dem er einen Lenin verherrlichenden Aufsatz von Leo Trotzki mit einem Seneca zugeschriebenen Text über Nero kreuzte. Anders als der Titel vermuten lässt, steht nicht Neros ermordete Gattin im Zentrum der Handlung, sondern das Phänomen der Tyrannei an sich.
Der eigentliche Star in dieser Inszenierung, die erstmals vor drei Jahren beim Holland Festival in Amsterdam realisiert worden war und nun am 17. Oktober im Stanislawski-Elektrotheater Premiere hatte, ist ein lorbeerbekränzter, bespielbarer Lenin-Kopf, an dem gleich zu Beginn eine Trepanation – eine Schädelöffnung – entlang der Stirn durchgeführt wird (Bühnenbild: Stepan Lukyanov).
Was geht im Kopf eines Tyrannen vor? Eine diffuse, unheimliche Klangwolke bildet die musikalische Basis, sie kommt vom Band. Die Idee dahinter: Es handelt sich um die ersten Takte der Warschawjanka, einem kommunistischen Revolutionslied, die mit einem Computerprogramm auf die etwa 80-minütige Dauer der Aufführung gedehnt wurden. Statt Musiker und Dirigent sitzt, für das Publikum nicht sichtbar, der Soundkünstler Oleg Makarov auf dem Balkon, der die weiteren Klänge – metallisches Stampfen, Pferdehufe, Backstage-Chor, usw. – gemäß partiturähnlichen Vorgaben im jeweiligen Moment einspielt oder erzeugt. Den ersten Auftritt hat der u.a. am Salzburger Mozarteum ausgebildete Bariton Alexey Kokhanov als Seneca. Sein mit kurz angedeuteten Kantilenen verzierter, fragil wirkender Sprechgesang changiert zwischen Falsett und Bruststimme.
Wie alle Solisten in dieser Produktion singt er nicht für den Raum, der im Stanislawski-Elektrotheater lediglich ca. 300 Sitzplätze fasst, sondern für die Mikroports. Man hört die Stimmen der Sänger selbst in der fünften Reihe nur aus den Lautsprechern, was eine seriöse musikalische Beurteilung, mit der Ausnahme der Feststellung einer stimmlich ausnahmslosen Klangschönheit, quasi unmöglich macht. Gewollt zerbrechlich wirkt auch der Tenor Sergei Malinin als Nero. Quält den Kaiser das schlechte Gewissen oder die Angst vor dem Fall? Manchmal sind Diktatoren mächtige Weicheier. Aber noch gehorchen ihm die Soldaten, hier dargestellt durch vier Rotarmisten. Mit gequälten und mitunter lächerlichen Bewegungen (Choreografie: Andrei Kuznetsov-Vecheslov) befehligen sie kopflose chinesische Terrakotta-Krieger, die den beiden geschichtlichen Ebenen (römische Antike und kommunistische Revolution) als dritte die chinesische Antike hinzufügen.
Von Zentaurenskeletten wird derweil in London eine Kutsche gezogen, in der Leo Trotzki in einer von Yury Duvanov ausgefüllten Sprechrolle Lenins Tod bedauert – manche Tyrannen erfahren eine nachhaltige Verklärung. Auf die Frage, warum er in diesem Werk Lenin und nicht etwa Stalin herangezogen hat, antwortet Yukhananov mit dem Hinweis, man müsse das Übel stets bei der Wurzel packen. Das Unkraut wächst freilich trotzdem nach, der natürliche Kreislauf des Bösen ist auch bei uns Menschen nicht auszumerzen. Dieser Gedanke bildete in den 1980er-Jahren gleichsam die Grundlage für der Kellertheaterfassung von »Octavia«: In der Zeit der Perestroika, so Yukhananov, herrschte eine blinde Euphorie, aber die Geschichte habe gezeigt, dass sie sich wiederhole. Das Stück sei als Warnung geschrieben worden, und dreißig Jahre später könne man konstatieren, dass seine Vorhersehung eingetreten ist – es sind weltweit wieder Diktatoren an der Macht, auch wenn sie vielfach unter dem Deckmantel der Demokratie agieren.
Kann demnächst sein 5-jähriges Bestehen feiern: Das Stanislawski-Elektrotheater in Moskau, ein Treffpunkt für neue Musik, Literatur und bildende Kunst.
Im Gegensatz zur Amsterdamer Uraufführung von »Octavia. Trepanation« fanden auf der engen Moskauer Bühne nur wenige Terrakotta-Krieger Platz, wodurch sich die Wirkung veränderte: Statt der in dem Werk thematisierten Tyrannengewalt gewinnt im Kammerspiel die ihm ebenfalls innewohnende Opferrolle an Stellenwert. Abgehakt, hoch und zugleich extrem gedehnt verläuft jene Gesangslinie, mit der Arina Zvereva als Geist von Neros Mutter Agrippina in einer langen Arie auf intensivste Weise Trotzkis Lobhudelei konterkariert. Erst am Schluss tritt das Hauptopfer Octavia als achtstimmiger Frauenchor auf und nimmt wehmütig Abschied vom Leben.
„Man muss das Übel bei der Wurzel packen.“
Eine Oper über Tyrannei – im Kopf von Lenin.
Was bleibt vom Besuch dieser Produktion? Neben eindrücklichen Bildern ist es ein echohaftes Nero-Gesangsmotiv, was als positives Zeichen gedeutet werden kann. Sowie die Erkenntnis, dass sich das StanislawskiElektrotheater in seinen ersten fünf Jahren offensichtlich ein neugieriges und risikofreudiges Stammpublikum erspielen konnte – die Karten für die erste Vorstellungsserie, die im Rahmen des internationalen „Territory“-Theaterfestivals stattfand, waren praktisch ausverkauft. Der Oper könnte zudem eine Aufnahme an großen Häusern beschieden sein, immerhin liegt sie auch in einer Orchesterfassung vor.
Kein Moskau-Besuch ohne das Bolschoi:
Ein großartiger »Don Carlos« mit Anna Nechaeva als Elisabetta.
Die russische Hauptstadt verfügt zudem in etwa über fünf Häuser, in denen regelmäßig Opern gespielt werden. Die Auswahl und Bandbreite ist dementsprechend groß, und doch wäre ein Moskau-Besuch ohne einer Vorstellung im Bolschoi-Theater unvollständig. Zu dieser Erkenntnis konnte man wangsläufig einen Tag später während einer Repertoirevorstellung der Verdi-Oper »Don Carlo« gelangen, die im historischen Haus des Bolschoi noch in der vieraktigen, bei Dramaturgen in den vergangenen Jahren in Ungnade gefallenen Mailänder Fassung von 1884 gespielt wurde.
Vom warm tönenden Intro der Hörner über das packende Terzett im zweiten und die dämonisch-düstere Großinquisitor-Szene im dritten Akt bis hin zum schaurigen, mächtigen Finale war die besuchte Aufführung schlicht mustergültig. Wuchtig breit und zugleich unbeirrt präzise sowie, etwa in Ebolis Schleierlied, mühelos leichtfüßig klang das Bolschoi-Orchester unter Dmitry Krukov. Zur fast ausschließlich aus Russen bestehenden Sängerbesetzung zählten auch international gefeierte Stars wie Ildar Abdrazakov, dessen Bass in einer seiner Paradepartien als Philipp II. an zusätzlicher Kernigkeit gewonnen hat. Mit einer prachtvollen Tiefe verwöhnten auch die beiden weiteren Bässe: Stanislav Trofimov, Ensemblemitglied am St. Petersburger Mariinsky-Theater als Großinquisitor und der Bolschoi-Sänger Denis Makarov als Mönch (Karl V.).
Generell wurde in gesanglicher Hinsicht – ganz nach russischem Klischee – einer ausladenden Raumfülle der Vorzug gegenüber italienisch geprägter Finesse gegeben, was freilich wertfrei gemeint ist. Schöne Attacken ritt der ebenfalls am Haus fest engagierte, dunkel-sonore Oleg Dolgov in der Titelpartie – er wird im kommenden Jahr Gastauftritte in Neapel, Nizza und Toulon absolvieren. Wonnig klang auch Igor Golovatenko, der bereits international unterwegs ist, obwohl er als fester Bolschoi-Bariton geführt wird. Er sang den Rodrigo (Marquis von Posa). Ein ebenfalls schon international gefragtes Ensemblemitglied ist Anna Nechaeva, die in der Partie der Königin Elisabeth mit einem wendigen, warmen und in der Höhe strahlenden Sopran beglückte. Die für ihre satte Tiefe bekannte Bulgarin Nadia Krasteva war Eboli, lediglich die Spitzentöne bereiteten der Mezzosopranistin ein wenig Mühe.
Man sagt dem Bolschoi-Theater verstaubte Inszenierungen nach, bei jener von Adrian Noble aus dem Jahr 2013 trifft das nicht zu. Zwar verzichtete der Engländer wenig überraschend auf eine persönliche Interpretation, und die Akteure treten in historisierenden Kostümen von Moritz Junge auf und dürfen meistens frei in der Nähe der Rampe singen, aber das kahle, zentralperspektivische und schön ausgeleuchtete Bühnenbild von Tobias Hoheisel (Lichtdesign: Jean Kalman) versorgt die Oper mit einer zeitgenössischen Ästhetik. Fazit: Wenn diese De-facto-Gala eine für Moskau representative Repertoirevorstellung gewesen ist, dann muss das Bolschoi derzeit zu den besten Opernhäusern der Welt gezählt werden.
S. Burianek